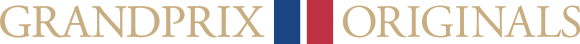Steve McQueen

Als Personen des öffentlichen Lebens nehmen Filmstars die Entstehung kollektiver Wünsche vorweg und geben diesem Wandel ein Gesicht. Im Mobilitätsrausch der Sechziger und Siebziger Jahre träumten viele von immer schnellerer Fortbewegung. Steve McQueen, einer der populärsten Hollywood Schauspieler seiner Zeit, gehörte zu den Galionsfiguren dieses neuen Lebensgefühls. Seine Siege auf der Piste, seine Boliden auf der Leinwand, sein privaten Motorräder, Flugzeuge und Sportwagen – sie alle wurden über das persönliche Image hinaus zu Symbolen seines sozialen Aufstiegs.
Ein kleines, spöttisches Lächeln, das die tiefblauen Augen aufblitzen lässt. Mehr nicht. Unter dem Stoff zeichnen sich die Muskeln ab. Wie bei seinen geliebten Rennwagen, deren elegante Karosserie die geballte Kraft unter der Motorhaube nicht verbergen kann. Auch ohne vieler Worte ist Steve McQueen auf Anhieb präsent. Das zeichnet seinen Stil aus und verrät seine komplexe Gefühlswelt.
McQueen bringt eine noch die da gewesene Mischung aus Konzentration und Lässigkeit, Beherrschtheit und viriler Stärke auf der Leinwand. Die Presse spricht ehrfürchtig vom „King of Cool“.
Steve McQueens Rennleidenschaft entspringt einer Sehnsucht, die eine ganze Generation prägt und zu deren Projektionsfläche er wird. „Ich weiß nicht, warum ich so berühmt bin“, sagt er ehrlich. „Vielleicht identifizieren sich die Leute mit mir, weil ich aus der Gosse komme.“ Sicher hat die Faszination, die er auf seine Fans ausübt, auch mit der Verwegenheit zu tun, mit der er über die Pisten jagt. So verkörpert er Mitte des 20. Jahrhunderts den Archetypus des männlichen Helden, der die Freiheit und das Abenteuer sucht.
Im Laufe seines Lebens kauft McQueen zahllose Motorräder – für Rennstrecken, Cross-Trails und schweres Gelände ebenso wie für die Straße. Darunter Modelle wie die Triumph Bonneville TR6SC, Suzuki, Husqvarna 400 CR, Indian Chief und Vincent HRD: ab den Siebziger Jahren sammelte er auch Oldtimer aus den Zwanzigern. Besonders begeistert ist er von dem Vèlosolex 3800, mit dem er sich während der Dreharbeiten zu Le Mans bestens amüsiert.
1957 juckt es Steve McQueen wieder: Er will einen Sportwagen. Auf seinen ersten Roadster, einen Siata 208 S, folgte ein Porsche 356 Speedster, ein Lotus Eleven und der äußerst seltene Jaguar XK S5. Zum 34. Geburtstag schenkt ihm seine Frau einen prächtigen Ferrari 250 GT Lusso. Etwas später fährt er auch einen weiteren exklusiven Ferrari, das elegante 275 GTS/4 NART Spyder Cabrio. 1969 erweitert McQueen außerdem seinen Porsche-Fuhrpark um einen Porsche 911S; dazu kommt später noch ein 911 Turbo.
Beim Rennen fährt Steve McQueen die begehrtesten Maschinen seiner Zeit. Nachdem er sich mit dem Porsche 356 und dem Eleven die Hörner abgestoßen hat, startet er auf einem Cooper T52 in der Formel Junior und tritt auch mit einem Austin-Healey Sebring Sprite, einem Porsche 908 oder 917 bei verschiedenen Wettkämpfen an. Auch bei Wüstenrennen ist er am Steuer eines von Vic Hickey konstruierten Offroad-Buggys, dem Hurst Baja Boot, ganz vorne mit dabei.
Aber diese Boliden sind natürlich nicht die einzigen Pferde, die er im Stall hat. Selbstredend hat Steve McQueen auch einen Mini Cooper S, wie damals jeder Star, der etwas auf sich hält. Außerdem einen VW Käfer, einen Mustang und eine Corvette. Für ausgedehnte Geländetouren legt er sich einen Jeep mit Chevy-V8-Motor und einen Land Rover zu, dazu einige Pick-ups von GMC, Chevrolet oder Ford, mit denen er auf seinen Ranches im kalifornischen Santa Paula und in Ketchum, Idaho herumfährt. Durch die Stadt kutschiert er mit einer Cadillac Viertürer Limousine, einem 1957er Chevrolet Bel Air Cabriolet, einem komfortablen Hudson Wasp Coupè oder einem Cadillac Series 62. Auf einen Excalibur folgt eine Mercedes 280 SE 3.5 Cabrio. Für kurze Zeit gesellt sich auch ein Rolls-Royce Corniche Cabrio dazu, aber McQueens Lieblingslimousine ist sein Mercedes 300 SEL 6.3.
Um den Reiz zu verstehen, den die Beschleunigung auf manche ausübt, muss man Sie als Mittel begreifen, aus sich herauszugehen und damit das metaphysische Bedürfnis zu stillen, über sich hinauszuwachsen. „Es gibt nichts Aufregenderes als Autorennen. Und im Gegensatz zu Drogentrips behält man dabei seine Würde“, sagt Steve McQueen, der als Konsument starker Rauschmittel wohl weiß, wovon er spricht. Obwohl seine Kopiloten oder Konkurrenten ihn als hoch konzentrierten, perfektionistischen und immer bestens vorbereiteten Fahrer beschreiben, ist sich McQueen durchaus bewusst, dass eine solche Leidenschaft irrationale Züge hat: „Wenn jemand derart besessen ist, hört er auf niemanden; er ist wie berauscht vom Dröhnen der Motoren.“ In gewisser Hinsicht ist es auch eine Flucht, denn auf der Piste kann er Problemen einfach davonfahren.
„Richtig entspannen kann ich nur, wenn ich auf einem Rennmotorrad oder in einem Sportwagen Gas gebe“, erklärt Steve McQueen vor Journalisten. Seine Figur in Thomas Crown ist nicht zu fassen liebt ebenfalls das Spiel mit der Gefahr: Die Szene, in der Thomas Crown sein Segelflugzeug dicht über den Baumwipfeln dahinrasen lässt, hätte auch in Steve McQueens Privatleben gedreht werden können. Als die junge Frau, die ihn am Boden erwartet, nach dem Grund für dieses riskante Flugmanöver fragt, antwortet Crown lakonisch, dass er sich dann wenigstens nicht mehr den Kopf zerbrechen müsste. Worüber denn, fragt Sie erstaunt. Mit schelmisch blitzenden Augen gibt McQueen alias Thomas Crown zurück: „Darüber, wer ich morgen sein will.“
Was das heimische und internationale Kinopublikum an Steve McQueen bewundert, ist aber nicht nur sein unbedingter Wille zum Fortschritt, sondern auch das Selbstbewusstsein, mit dem er sich vom System abgrenzt und andere ebenso wie sich selbst immer wieder herausfordert – zu einem Kampf, bei dem soziale Kategorien keine Rolle spielen. „Ich liebe den Rennsport in all seinen Varianten. Der Kerl neben mir interessiert sich einen Dreck dafür, wer ich bin. Er ist nur darauf aus, mich zu schlagen.“ Um zu beweisen, wozu er fähig ist, scheut sich McQueen auch nicht, auf ein zentrales Element des Rennsports zu setzen: das Risiko.
Leidenschaft hat ihren Preis
Sein Leben lange sucht Steve McQueen das Glück, indem er permanent an seine Grenzen geht. Seine Motorräder, Autos und Flugzeuge sind ein Mittel zur Flucht, eine Eintrittskarte in eine andere, bessere Welt. Dafür wendet er nicht nur viel Zeit und Geld auf, sondern investiert auch körperlich viel Kraft und Energie, denn der Autosport ist psychisch wie physisch eine Belastungsprobe.
Am Steuer eines Boliden zu sitzen erfordert nicht nur äußerste Konzentration und Wachsamkeit; man muss auch körperlich in Topform sein. Im Film Le Mans vermitteln die Rennszenen zwar einen authentischen Eindruck von den Adrenalinstößen, der Anspannung und der Erschöpfung der Piloten – man hört ihren hämmernden Herzschlag in den Sekunden vor dem Start oder hat das Gefühl, neben ihnen im Cockpit zu sitzen- aber die Hitze kann man sich nicht vorstellen. Denn der Käfig aus Glas und Metall, in dem die Fahrer eines Rennprototyps eingeschlossen sind, ist ein Brutkasten. Um das Gewicht so weit wie möglich zu reduzieren, werden die meisten Verkleidungen entfernt, darunter auch die Hitzeschmutzmatten. Das Getriebe und der Kardantunnel, der unter dem kleinen Cockpit verläuft, werden immer heißer, und wenn auch noch die Sonne auf die Strecke knallt, klettert das Thermometer im Wagen auf sechzig, siebzig Grad. Zu diesen höllischen Temperaturen kommen die nervliche und körperliche Erschöpfung, mitunter auch Hunger und Durst, da die Montur des Fahrers – Feuerschutzanzug, Haube, Helm, Stiefel und Handschuhe, die bei Bränden und Karambolage nur dürftigen Schutz bieten – ihn zusätzlich ins Schwitzen bringt. Wenn die Nacht anbricht, blitzen bei dem in unfassbarem Tempo ausgetragenen Kampf mit den andren Boliden gleißende Lichter auf. Die überanstrengten Augen beginnen zu schmerzen. Wie auch immer das Klassement aussieht – nach dem Rennen ist der Pilot mit seinen Kräften am Ende.
Wenn man also trotzdem noch von Steve McQueen und seinen Maschinen träumt, vom Reiz der Gefahr und vom Rausch der Geschwindigkeit, schwingt darin eine gewisse Wehmut und eine ritterliche Romantik mit. „Die Geschwindigkeit war immer mein einziger Daseinszweck, mein Rettungsring – eine Freundin, der ich mich ganz und gar hingeben konnte, ohne betrogen zu werden“, gab der Schauspieler einmal zu. Der Star, dem seine Freiheit über alles ging, würde sich heute wohl sehr eingeengt fühlen, umgeben von hysterischen Medien, übervorsichtigen Agenten und einer öffentlichen Meinung, die Exzesse nur billigt, wenn sie Spezialeffekte sind. Die Geschwindigkeit trägt den Geschmack der verbotenen Frucht in sich; sie ist ein stimulierendes Mittel und ein gefährliches Gift, das den, der davon kostet, töten kann. So ist es gerade auch dieser Reiz des Verwegenen, Verbotenen, der Steve McQueen so unwiderstehlich macht und der noch Jahrzehnte nach seinem Tod bei einer Generation, die ihn nicht auf der Kinoleinwand erlebt hat, Bewunderung und Faszination auslöst. Zu Lebzeiten war er ein Hoffnungsträger, eine Symbolfigur für Freiheit und Unangepasstheit; heute wird er nostalgisch verehrt, als ikonengleiche Verkörperung einer vergangenen Zeit und einer unerfüllten Verheißung. Indem er sich festgefahrenen Normen und engen Wertvorstellungen konsequent verweigert hat, ist Steve McQueen zum Inbegriff des charmanten Rebellen geworden.